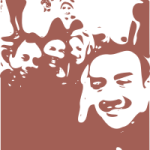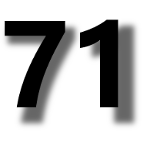Bei den meisten Wahlen in der Vergangenheit habe ich, bis auf wenige Ausnahmen, bei Wahlen meine Stimme den Grünen gegeben. Zugeben: einige Male war es, was ja in Österreich ein häufig vorkommendes Phänomen ist, die Wahl des „geringsten Übels“.
Diesmal ist es anders: ich werde die Grünen aus Überzeugung wählen. Ich habe in der Vergangenheit viele engagierte grüne FunktionierInnen und -aktivistInnen kennengelernt, und September durfte ich Eva Glawischnig auch persönlich, in einem kurzen Gespräch kennenlernen. Auch wenn für mich das Programm einer Partei noch immer im Vordergrund steht, so war ich dennoch positiv von ihrer netten, am Boden geblieben Art überrascht. Klassischer Fall von: kommt im Fernsehen negativer rüber als im persönlichen Umgang. Jetzt kann ich die Grünen also nicht trotz Eva, sondern auch wegen Eva wählen.
Auch für die Lektüre des grünen Wahlprogramms habe ich mir intensiver angesehen, auch wenn dem/der Politikinteressierten die meisten Standpunkte bereits bekannt sein dürften. Programmatisch wäre ich zwar auch potentieller SPÖ- Wähler, wenn man sich zum Beispiel das Thema „gemeinsame Schule“ oder Vermögensbesteuerung ansieht. Allerdings hat diese Partei, beziehungsweise ihre ProponentInnen an vorderster Front hinlänglich bewiesen, dass sie bei den wichtigen Fragen sich meist gegenüber ihrem Koalitionspartner nicht durchsetzen kann beziehungsweise sich von selbigen in den vergangenen Jahren immer wieder über den Tisch ziehen lassen kann.
Statt dem sperrigen (wenn auch wichtigen, aber schwer vermittelbaren) Thema „Energiewende“, wie beim letzten Mal haben die Grünen dieses mal voll auf das Thema Anti-Korruption gesetzt, eine gute Entscheidung, wie ich finde. Denn immerhin haben sie in Kärnten und Salzburg bewiesen, dass sie durch unermüdliche Arbeit Skandale aufdecken und damit erstarrte Strukturen in Bewegung bringen können. So wäre Kärnten ohne die Grünen und Rolf Holub vermutlich auch heute noch blau-orange-braun.
Sämtliche anderen Parteien im Parlament werden über Jahre hinaus unglaubwürdige bleiben, was den Kampf gegen Korruption betrifft: schwarz ist tief in entsprechende Skandale verstrickt, und auch der FPÖ und Ihrer diversen Spinnoffs namens BZÖ oder (indirekt) Team Stronach (mit Abgeordneten die man nur mehr als dritte Wahl bezeichnen kann), die vor Jahren noch gegen den „rot-schwarzen Filz“ gewettert haben, sind spätestens mit Schwarzblau für einige Jahre selbst Teil dieses Filzes geworden. Die strafrechtlichen Konsequenzen dieser Zeit werden die Gerichte noch über Jahre beschäftigen.
Warum nicht eine Kleinpartei wählen?
Vor einiger Zeit noch waren neue, junge „unkonventionelle“ Parteien, die in der politischen Landschaft Österreichs auftauchten, in diversen Medien präsent. Bis auf wenige Ausnahmen ist es nun recht still um sie geworden, und so treten nunmehr nur mehr drei weitere österreichweit an: Piraten, NEOS und die KPÖ.
Die Piraten sind für mich nicht wählbar, weil sie sich einerseits durch interne Streitereien hevorgetan haben – sie haben sich also binnen kürzester Zeit den Habitus so mancher „Altpartei“ angeeignet. Andererseits empfinde ich sie, auch wenn sie versuchen, andere Themen zu besetzten, nach wie vor als „Single Issue“ – Partei. Und Netzpolitische Themen gibt es schon seit Jahren auch bei den Grünen, aber eben nicht ausschließlich oder in der Hauptsache.
Die NEOS vertreten zwar einige vernünftige Standpunkte, die auch andere Parteien im Programm haben wie beispielsweise die Finanztransaktionssteuer oder auch die rechtliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen, wer sich das Wahlprgramm aber näher durchliest, stößt schnell auf neoliberales Gedankengut Marke „Steuern runter!“ ( Partei „Sugar Daddy“ Haselsteiner hätte da eine vernünftigere Haltung, aber die steht nicht im Parteiprogramm) oder etwa die Forderung nach weiteren Privatisierungen. Für mich nicht mehr als eine Mischung aus Junger ÖVP und LIF minus zu radikalem Gesellschaftsliberalismus (die Ehe von Schwulen und Lesben hat es nicht ins Parteiprogramm geschafft). Eine Partei, den „freien Markt“ – in leicht abgeschwächter Form – weiter als all- seligmachend ansieht, ist für mich außerdem schlicht nicht wählbar.
Die KPÖ? Ich kenne viele nette und vernünftige Leute aus dieser Partei, und auch das Programm beherbergt viele Punkte, die ich sofort unterschreiben würde. Allein: sie werden es auch diesmal nicht ins Parlament schaffen, und das verlässlicher als bei den anderen Kleinparteien. Das wird sich auch so lange nicht ändern, so lange die KPÖ nicht in einer neuen linken Partei aufgeht. Wie es Mirko Messner auch sagt: ein schlichter „Namenstausch“ reicht dafür nicht aus. Leider ist die Linke in Österreich für ein solches Projekt nach wie vor noch zu zersplittet.
Einer dieser Kleinparteien die Stimme zu geben, würde, und das wird sich so lange nicht ändern, so lange es die 4% zum Einzug ins Parlament gibt, wäre leider außerdem mit hoher Wahrscheinlichkeit eine verlorene Stimme. Die Grünen dagegen sind schon drin, sie haben viele kluge und richtige Dinge im Parteiprogramm. Und: sie haben sich bisher, im Vergleich zu den anderen Parlamentsparteien noch nichts grobes zu Schulden kommen lassen.
Ich höre oft, dass es „die Grünen auch nicht anders machen werden, wenn sie einmal an die Macht kommen“ . Das ist aber bis dato einfach ein dummes Vorurteil. Warum soll man den Grünen nicht die Chance geben zu beweisen, dass sie es – hoffentlich bald als Regierungspartei im Bund – anders, besser machen als die Anderen?
Nach unzähligen Jahren rotschwarzen Stillstands, unterbrochen von der Ära des schwarzblauorangen rassistisch-neoliberalen Selbstbedienungsladens Österreich wäre es doch höchst an der Zeit, einmal etwas Neues zu versuchen.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die ÖVP in Opposition gehen sollte.